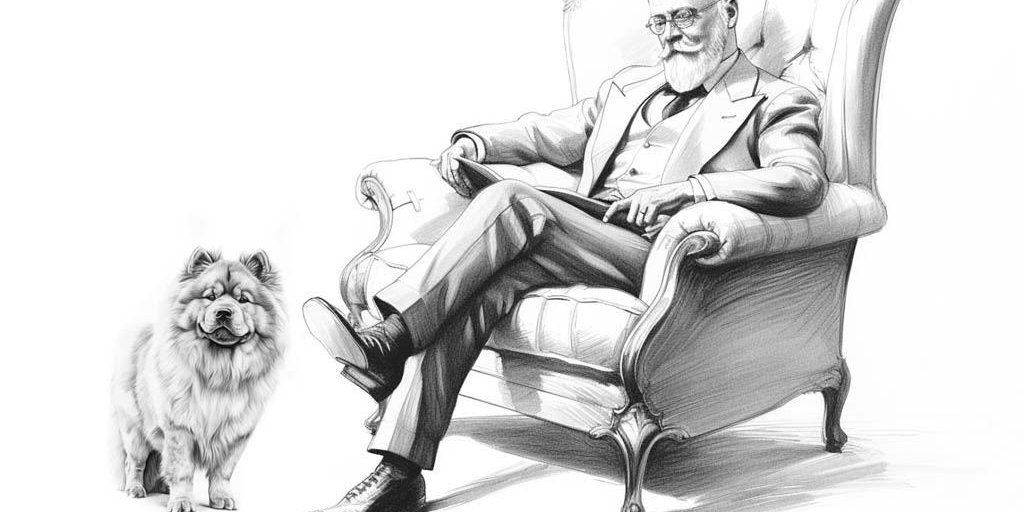Verhaltensforschung
Wie Hunde die menschliche Sprache entschlüsseln
Immer wieder staunen Hundefreunde darüber, wie erstaunlich gut ihre Vierbeiner Worte verstehen und auf Zuruf das richtige Spielzeug aus der Kiste fischen. Doch wie weit reicht das Sprachverständnis von Hunden tatsächlich? Eine neue Studie geht dieser Frage auf den Grund und untersucht, ob Hunde sogar in der Lage sind, Begriffe wie „ziehen“ oder „werfen“ auf völlig neue, unbekannte Spielzeuge mit derselben Funktion zu übertragen. Die Forschungsergebnisse liefern überraschende Einblicke in das kognitive Potenzial unserer Hunde.
Eine aktuelle Studie von Claudia Fugazza und ihrem Team von der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest wirft einen faszinierenden Blick darauf, wie Hunde Wörter nicht nur für einzelne Objekte lernen, sondern diese auch auf neue Gegenstände mit gleicher Funktion übertragen können. Im Fokus stehen außergewöhnlich sprachbegabte Hunde, die in spielerischer Interaktion mit ihren Besitzern Objektnamen und deren Bedeutung erfassen. Die Forscher wollten herausfinden, ob Hunde tatsächlich funktionale Kategorien bilden können – ähnlich wie kleine Kinder beim Spracherwerb. Es wurde untersucht, ob Hunde Begriffe wie „ziehen“ oder „werfen“ nicht nur mit einem Spielzeug verbinden, sondern auch auf neue, unbekannte Spielzeuge anwenden. Die Ergebnisse eröffnen spannende Einblicke in das Denken und die Intelligenz unserer vierbeinigen Freunde.
Können Hunde Objektbezeichnungen „verallgemeinern“?
Die im September 2025 veröffentlichte Untersuchung von Claudia Fugazza und Kollegen drehte sich um die Frage, wie weit die sprachlichen Fähigkeiten bestimmter Hunde tatsächlich reichen. Im Mittelpunkt standen sogenannte „Gifted Word Learner“-Hunde, die in der Lage sind, erstaunlich viele Spielzeugnamen zu lernen – teilweise über hundert Begriffe. Doch können diese Hunde erworbene Namen wie „Ziehen“ oder „Werfen“ auch auf bislang unbekannte Objekte anwenden, die zwar dieselbe Funktion, aber eine völlig andere Form und Beschaffenheit haben? Dies wurde mit einem mehrstufigen Versuchsaufbau geprüft, der möglichst alltagsnahes Spielen zwischen Hund und Mensch simuliert
So lief das Experiment ab: Spielen, Lernen, Übertragen
Zunächst lernten die Hunde zwei Gruppen von Spielzeugen kennen, die jeweils immer nach dem gleichen Prinzip benutzt wurden: Die eine Gruppe wurde ausschließlich zum Ziehen (also Zerrspiele), die andere ausschließlich zum Werfen und Apportieren eingesetzt. Die Besitzer benannten die Spielzeuge dabei konsequent mit Begriffen wie „Ziehen“ oder „Werfen“ – egal, wie die einzelnen Gegenstände aussahen. Nach einigen Wochen mussten die Hunde unter mehreren bekannten und unbekannten Spielzeugen anhand dieser Wörter das richtige auswählen.
In der nächsten Phase wurden neue, vollkommen unbekannte Spielzeuge eingeführt; diesmal nannte der Mensch beim Spielen jedoch keine Bezeichnung mehr – es wurde wie gewohnt gezogen oder geworfen, aber ohne dies verbal zu benennen. Schließlich kam der spannende Moment: Die Hunde sollten auf Zuruf den passenden neuen Gegenstand bringen („Bring mir das "Zieh"-Spielzeug), obwohl sie diese Bezeichnung nie in Zusammenhang mit dem neuen Objekt gehört hatten.
Das beeindruckende Resultat: Die meisten Hunde konnten die Bedeutung der Wörter tatsächlich auf die neuen Objekte übertragen, wenn die Spielart dieselbe war. Sie ließen sich also nicht von Aussehen oder Material täuschen, sondern achteten darauf, wofür das Spielzeug eingesetzt wurde. Damit zeigten sie eine Fähigkeit, die bisher nur aus der frühen Sprachentwicklung bei Kindern bekannt war.
Was bedeutet das für Hundebesitzer? Praktische Erkenntnisse
Die Studie liefert nicht nur Erkenntnisse für die Wissenschaft, sondern wirkt auch in den Alltag von Hundemenschen hinein: Sie zeigt, dass Hunde viel mehr als dressierte "Affen" sind – ihre kognitiven Fähigkeiten werden durch gemeinsames Spielen und wiederkehrende Rituale enorm gefördert. Wer konsequent Begriffe für Spielweisen verwendet („Hol das Wurfspielzeug X!“, „Zieh!“), kann seinem Hund also tatsächlich helfen, abstrakter zu denken und Worte sinnvoll zu verknüpfen.
Allerdings: Die hier untersuchten Hunde sind ausgesprochen talentiert im Wörter-Lernen – durchschnittliche Hunde lernen meist weniger Begriffe. Sie profitieren aber genauso von abwechslungsreichen und sprachlich begleiteten Spielen. Die Forscher empfehlen, klar unterscheidbare Spielweisen und ggf. dazu passende Wörter im Alltag einzuführen.
Im Kern gilt: Jede gemeinsame Aktivität, bei der ein und dasselbe Wort mit einer bestimmten Handlung verbunden wird, kann nicht nur den Spielspaß, sondern auch die geistige Entwicklung des Hundes fördern – und die Mensch-Hund-Beziehung vertieft sich ganz nebenbei.
Die vorliegende Studie leistet einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der kognitiven Fähigkeiten von Hunden, indem sie aufzeigt, dass diese Tiere in der Lage sind, gelernte verbale Bezeichnungen funktional zu generalisieren und auf neue, bislang unbekannte Objekte zu übertragen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zumindest besonders wortlernfähige Hunde nicht allein auf äußere Merkmale angewiesen sind, sondern über eine Form der funktionalen Klassifikation verfügen, wie sie bislang vor allem aus der frühen Sprachentwicklung des Menschen bekannt war. Damit bietet diese Forschung neue Ansatzpunkte für die vergleichende Kognitionsforschung und wirft gleichermaßen Fragen nach den zugrundeliegenden Mechanismen des Lernens beim Hund auf. Insgesamt unterstreichen die Befunde das Potenzial von Hunden als Modellorganismus zur Erforschung grundlegender Prinzipien von Sprache, Kognition und symbolischer Repräsentation außerhalb des Menschen.
Zur vollständigen Studie: Dogs extend verbal labels for functional classification of objects